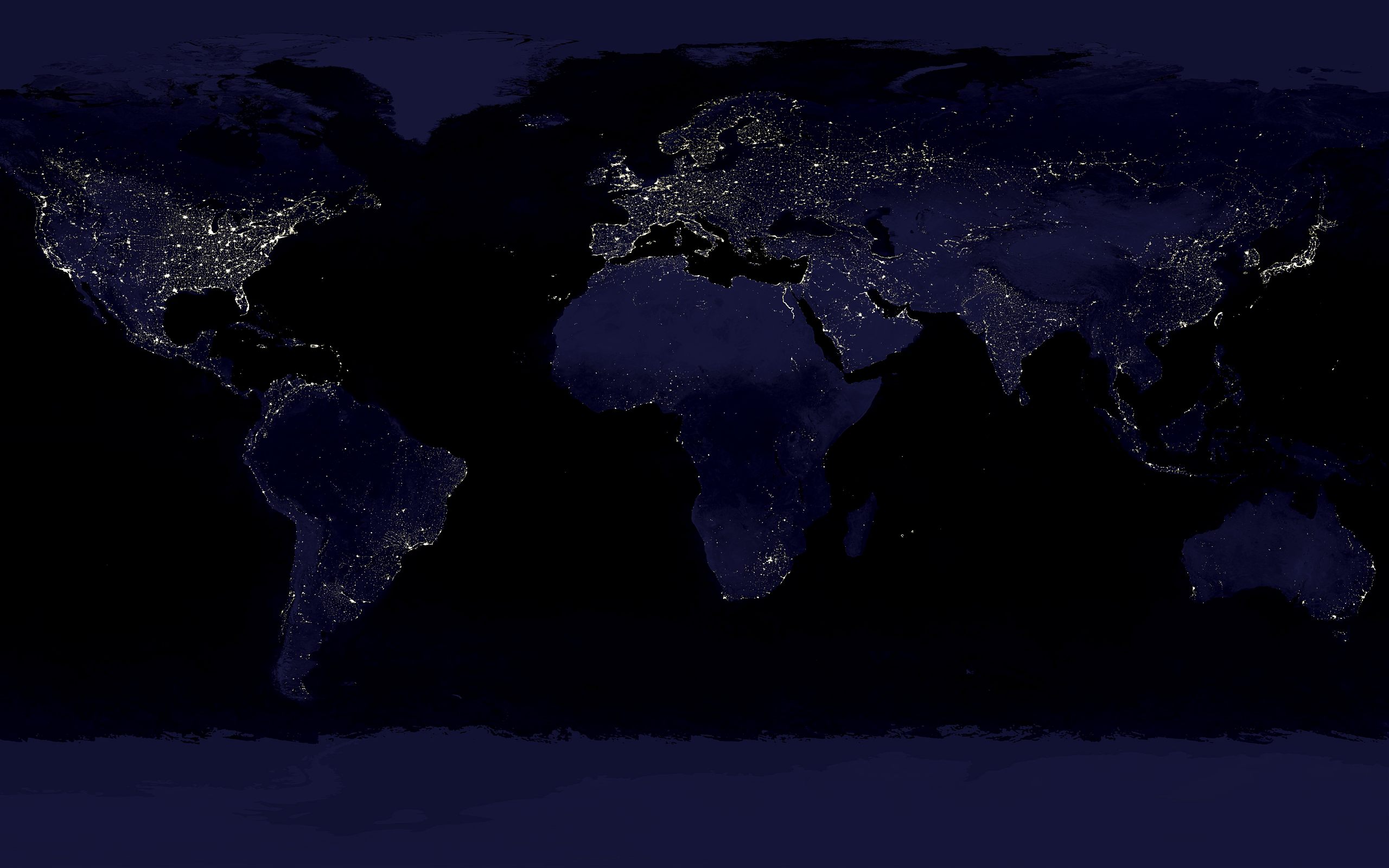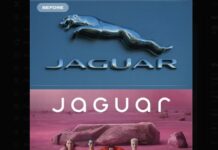Der Bericht des Wissenschaftsmagazins «Science» umfasst dreihundert Seiten und verurteilt den renommierten Hirnforscher Eliezer Masliah. Er behandelt eine Forschungspublikation nach der anderen, insgesamt über 130, von 1997 bis heute. In all diesen Veröffentlichungen finden sich Unregelmäßigkeiten, die zu einer eindeutigen Schlussfolgerung führen: Masliah hat Daten gefälscht, wiederholt und systematisch.
Masliahs herausragende Karriere fußte auf diesen Arbeiten. Zuletzt leitete er die Abteilung für Neurowissenschaften am National Institute on Aging, welches Teil der US-Gesundheitsbehörde NIH ist. Als hoch angesehener Wissenschaftler verwaltete er jährlich Forschungsgelder in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar und präsentierte seine Forschungsergebnisse auf zahlreichen Konferenzen. Seine Publikationen dienten vielen anderen Wissenschaftlern als Grundlage für ihre Forschungen. Seine mutmaßlichen Erkenntnisse beeinflussten maßgeblich die Forschung zu Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Auf Basis seiner Arbeiten wurden Medikamente entwickelt und an Patienten erprobt.
Die Entdeckung, dass wesentliche Grundlagen der Alzheimer-Forschung gefälscht sein könnten, hätte gravierende Folgen für die Wissenschaft und die Betroffenen. Es würde bedeuten, dass möglicherweise jahrzehntelange Forschungsarbeit auf falschen Prämissen beruhte, was die Suche nach effektiven Behandlungen und das Verständnis der Krankheit erheblich beeinträchtigen könnte. Für Menschen mit Alzheimer und deren Angehörige wäre dies eine besonders schwere Nachricht, da ihre Hoffnung auf Fortschritte in der Forschung und Verbesserung der Lebensqualität dadurch einen Rückschlag erleiden könnte.
Ergebnisse in Photoshop passend gemacht
Die vermuteten Fälschungen von Masliah scheinen einfach durchgeführt worden zu sein. Es wird ihm zur Last gelegt, Abbildungen entweder manipuliert oder wiederholt eingesetzt zu haben. Das bedeutet konkret: Zwei Bilder, die vorgeblich unterschiedliche Experimente darstellen sollen, sind tatsächlich bis in die Einzelheiten identisch. Es handelt sich dabei einmal um Mikroskopiebilder von Mäusegehirnen, ein andermal um sogenannte Western Blots, die zum Nachweis spezifischer Proteine dienen.
Es ist noch nicht erwiesen, ob diese Manipulationen eine absichtliche Fälschung darstellen. Experten, die den Bericht über Masliah gelesen haben, sind sich jedoch einig, dass der Fall klar zu sein scheint. Christian Haass, Professor am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in München, ist einer von ihnen. “Die enorme Anzahl der Unregelmäßigkeiten ist schockierend”, erklärt er. “Das deutet stark auf Betrugsabsichten hin.” Das NIH hat offiziell verkündet, dass Masliah in zwei Publikationen wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Aktuell ist er nicht mehr in seiner Position als Direktor tätig.
Fälschungen haben weitreichende Folgen
Für einige Forscher stürzt damit eine Welt ein. Christian Behl, Direktor des Instituts für Pathobiochemie an der Universitätsmedizin Mainz, beschäftigt sich seit über dreißig Jahren mit Alzheimer-Forschung. “Ich kenne Masliahs Arbeit seit den Neunzigern und hatte nie den geringsten Zweifel an seiner Integrität”, erklärt er. Aber die Beweise sind nicht zu leugnen. “Das bedeutet einen enormen Vertrauensverlust. Und man stellt sich die Frage: ‘Was ist überhaupt noch glaubwürdig?'”
Masliah hatte schließlich einen bedeutenden Einfluss auf das Forschungsfeld, und das nicht nur seit seiner Verwaltung der Budgets für die Alzheimerforschung bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde. “Er hat grundlegende Arbeiten geleistet”, so Behl. Dieser Einfluss zeigt sich auch in der hohen Anzahl von Zitaten in den Publikationen anderer Wissenschaftler.
Besonders besorgniserregend ist, dass auf Masliahs Forschung potenzielle Medikamente aufbauen. Ein Beispiel ist der Antikörper Prasinezumab, der in klinischen Studien zur Behandlung von Parkinson erprobt wird. Die ersten Ergebnisse waren enttäuschend: Prasinezumab erwies sich in einer Studie als unwirksam und verursachte zudem erhebliche Nebenwirkungen.
«Man müsste jetzt eigentlich in allen Arbeiten von Masliah nachkontrollieren, ob die Ergebnisse stimmen. Aber das ist eine riesige Aufgabe, die eine offizielle Untersuchungskommission übernehmen muss», sagt Christian Haass. Doch breche mit den Zweifeln an Masliahs Arbeit nicht gleich das gesamte Forschungsfeld zusammen. Denn die entscheidenden Experimente würden immer von anderen Forschungsgruppen wiederholt. Nur wenn diese zum gleichen Ergebnis kämen, baue man weiter darauf auf.
Die Liste der Fälscher ist lang
Der Fall Masliah erschüttert das Vertrauen in die Forschung neurodegenerativer Erkrankungen besonders, da er den Höhepunkt einer langen Serie von Fälschungsfällen darstellt.
Zu ihnen zählt der Hirnforscher Marc Tessier-Lavigne, der 2023 nach Vorwürfen der Manipulation als Präsident der Eliteuniversität Stanford zurücktrat. Ebenso Berislav Zlokovic, ein führender Alzheimerforscher an der University of Southern California, der beschuldigt wird, nicht nur selbst Daten und Bilder manipuliert, sondern auch seine Mitarbeiter dazu angehalten zu haben. Auch Domenico Praticò von der Temple University in Philadelphia ist betroffen. Seit 2022 wurden neun seiner Forschungsarbeiten aufgrund von manipulierten Bildern zurückgezogen.
Der Fall von Sylvain Lesné von der University of Minnesota war besonders auffällig. Eine Untersuchung des Journals „Science“ im Juli 2022 ergab, dass Abbildungen in einer einflussreichen Studie, die 2006 in „Nature“ veröffentlicht wurde, sowie in vielen weiteren Arbeiten von Lesné bearbeitet worden waren. Im Juni 2024 hat „Nature“ die Studie aufgrund von „Anzeichen exzessiver Manipulation“ in mehreren Bildern offiziell zurückgezogen.
Die reine Anzahl dieser Fälle in so kurzer Zeit wirft die Frage auf: Gibt es ein fundamentales Problem in der Alzheimer- und Parkinson-Forschung?
„Ich bin der Ansicht, dass Betrug in der Alzheimerforschung nicht häufiger vorkommt als in anderen Fachbereichen“, erklärt Ulrich Dirnagl, Leiter des Quest Center for Responsible Research am Berliner Institut für Gesundheitsforschung an der Charité. Jedoch sei dieser Bereich momentan besonders im Fokus – und wo intensiver untersucht wird, dort werden auch mehr Unregelmäßigkeiten entdeckt.
Die Anreize sind hier besonders groß: Die USA investieren dieses Jahr fast vier Milliarden Dollar an öffentlichen Mitteln in die Demenzforschung. Es locken also beträchtliche Summen und Prestige, was die Versuchung zum Betrug erhöhen könnte.
Karl Herrup, ein Alzheimerforscher an der University of Pittsburgh, meint, dass das umfangreiche Forschungsbudget bei einigen Kollegen offenbar zu Überheblichkeit und einem Gefühl der Unfehlbarkeit geführt hat: “Wenn experimentelle Daten den Vorhersagen der Forscher nicht entsprechen – nun, dann müssen die Daten wohl falsch sein! Aus dieser Perspektive scheint es nur logisch, sie mit Photoshop ‹zu korrigieren›.”
Herrup sieht die Alzheimerforschung in einer Sackgasse, da die Amyloid-Hypothese zu lange vorherrschend war. Diese Hypothese behauptet, dass Beta-Amyloid-Ablagerungen im Gehirn der primäre Auslöser für Alzheimer sind. Fast drei Jahrzehnte lang konzentrierte sich die Forschung auf diese Amyloid-Plaques, und auch die Studien von Lesné und Masliah unterstützten diese Theorie. Allerdings fehlt bis heute der definitive Beweis, dass die Amyloid-Plaques tatsächlich die Ursache und nicht nur eine Begleiterscheinung der Alzheimerkrankheit sind.
In den letzten Jahren äußern immer mehr Kritiker, darunter Herrup, Bedenken, dass die stagnierenden Fortschritte in der Alzheimer-Therapie auf eine übermäßige Konzentration der Forschung auf die Amyloid-Hypothese zurückzuführen sind.
In den USA sind in den letzten Jahren drei Medikamente zur Behandlung von Alzheimer zugelassen worden. Diese wirken, indem sie die Amyloid-Plaques im Gehirn reduzieren. Allerdings können sie den kognitiven Verfall bislang nur in geringem Maße verlangsamen.
Die Interpretation dieses Ergebnisses ist jedoch verschieden: Befürworter sehen in der Tatsache, dass die neuen Medikamente wirken, einen Beweis für die Bedeutung von Amyloid. Kritiker hingegen betrachten die geringe Wirksamkeit in der Praxis als Nachweis des Gegenteils.
Es steht außer Frage, dass die Alzheimer-Forschung vor einem Problem steht: Trotz jahrzehntelanger intensiver Forschung gibt es bislang keinen signifikanten Durchbruch. Zudem erlebt sie derzeit eine ernsthafte Vertrauenskrise in ihre Grundlagen. Die Art und Weise, wie die uneinigen Forscher diese Herausforderung bewältigen, wird weitreichende Konsequenzen für Millionen von Patienten haben.
Bild: ID 104065762 | Als © Kiosea39 | Dreamstime.com

Werden Sie Teil unserer Community und unterstützen Sie uns! Sie können uns in den Sozialen Netzwerken am besten auf Telegram oder auf X oder Facebook folgen, um unsere Inhalte zu empfangen. Oder noch besser melden Sie sich für unseren Newsletter an, um die Neuigkeiten des Tages zu erhalten.
Gerne können Sie auch Premium-Mitglied werden oder uns durch eine wirklich hilfreiche Spende unterstützen. Herzlichen Dank im voraus!
Abonnieren Sie unseren Newsletter