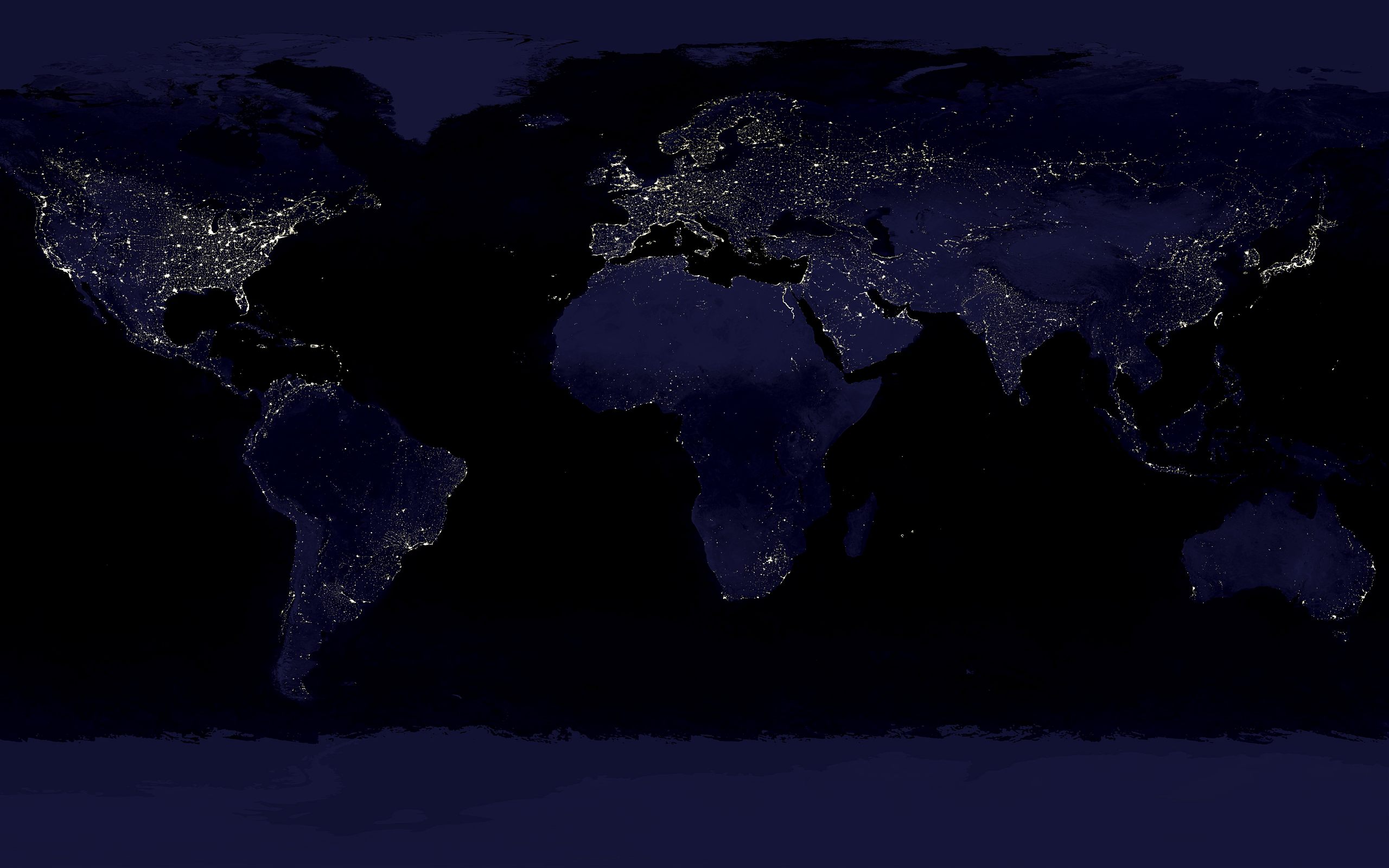Der Ausdruck “Mainstream-Medien” hat sich zu einem Kampfbegriff entwickelt, um etablierte Medienhäuser als befangen, zu linksgerichtet, zu staatsnah oder zu konformistisch abzustempeln.
Besonders rechte und extrem linke Politiker neigen dazu, solche Anschuldigungen zu erheben. Am vehementesten sind Verschwörungstheoretiker, die davon überzeugt sind, dass Medien aus böswilligen Gründen Informationen zurückhalten oder die Öffentlichkeit gegen ihr besseres Wissen manipulieren. Aus dem Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien haben sich sogenannte alternative Medien gebildet, deren Ziel es oft ist, grundsätzlich “Anti-Mainstream” zu sein.
Journalisten, die darauf bedacht sind, nur das zu veröffentlichen, was auch ihre Kollegen schreiben oder billigen, machen sich genauso von der herrschenden Meinung abhängig. Während Journalisten mit einer Antimainstream-Haltung sich zumindest noch einreden können, sie würden eine alternative Sichtweise bieten, tragen solche, die aus Furcht, Überzeugung oder Konformität handeln, zur Einschränkung des Diskurses bei.
Als Journalist muss man sich bemühen, sich von Stereotypen zu lösen und sich nicht von Trotz oder dem Wunsch nach Zustimmung leiten zu lassen – ein schwieriges Unterfangen in einer der selbstverliebtesten Branchen der Welt. Der zwanghafte Versuch, Teil des medialen Establishments zu sein, ist ebenso einschränkend wie dessen kategorische Ablehnung. Trotzdem sollte man sich keinen Illusionen über die Tendenz zum journalistischen Einheitsbrei hingeben.
Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen 2020 löste einen landesweiten Skandal aus. Thomas Kemmerich, der Kandidat der kleinen FDP, wurde mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Mehrheit der Medien vertrat die Meinung, dass Kemmerich die Wahl hätte ablehnen sollen, da sie durch die Stimmen der AfD ermöglicht wurde.
Es stellt sich auch die grundsätzliche Frage: Wenn bürgerliche Parteien nicht mehr antreten, weil sie Angst haben, von der AfD gewählt zu werden, dann verleihen sie dieser Partei nur mehr Gewicht und verraten dabei ihre eigenen Prinzipien.
“Spiegel Online” berichtete einen Tag später: “Die Kritik vieler Kommentatoren ist vernichtend – doch ein Schweizer betrachtet die AfD-Stimmen für Kemmerich nicht als Makel.” Man könnte den Standpunkt vertreten, dass dieser es einfach nicht verstanden hat. Andererseits könnte man hinterfragen, warum in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern nahezu alle Medien mehr oder weniger denselben Kommentar veröffentlichen: Schande, Dammbruch, Tabubruch?
Die Berichterstattung während der Flüchtlingskrise 2015 war ähnlich einheitlich. Die deutschen Medien berichteten im Eifer der Willkommenskultur. Syrische Familien und Kinder wurden bevorzugt dargestellt. Unvergesslich bleibt, wie Kleinkinder am Münchner Bahnhof Teddybären in Empfang nahmen und freiwillige deutsche Helfer Beifall spendeten. “Applaus für die Ankommenden”, titelte die “Süddeutsche Zeitung”. Monate später kamen die Statistiken: 70 Prozent der Asylantragsteller von 2015 waren Männer.
Die Fotos syrischer Familien dienten als Basis für die Selbsttäuschung der Journalisten und der deutschen Öffentlichkeit – eine Fremdeneuphorie, die das Land ergriff. Eine Studie der Hamburg Media School und der Universität Leipzig ergab 2017, dass deutsche Tageszeitungen die Parolen der politischen Elite kritiklos übernahmen und eine euphemistisch-persuasive Ausdrucksweise des Begriffs Willkommenskultur verbreiteten, wodurch die Journalisten seit 2015 zu einer tiefen Spaltung des Landes beitrugen.
Ein wiederkehrendes Muster zeigt sich in der Berichterstattung der meisten Medien: Man unterstützt die Klimajugend im Kampf gegen die Klimakatastrophe und vermittelt den Eindruck, dies sei das große Anliegen einer ganzen Generation. In der Coronakrise bekämpft man gemeinsam die Ungeimpften und stilisiert sie zu Sündenböcken der Pandemie. Man gibt sich der kollektiven Illusion hin, die Ukraine stehe kurz vor einem Sieg gegen Russland.
Journalisten tendieren dazu, ihre Wünsche als Realität darzustellen, was die Genauigkeit ihrer Berichte und die Glaubwürdigkeit des Journalismus beeinträchtigt. Wenn sich Ereignisse nicht nach ihren Vorstellungen entwickeln, versuchen sie, die öffentliche Wahrnehmung zu korrigieren, indem sie vor der AfD, Rechtspopulismus und Trump warnen – der «Spiegel» zeigte ihn auf dem Titelblatt, wie er die Freiheitsstatue enthauptet, eine Ku-Klux-Klan-Kapuze trägt oder als Feuerball auf die Erde zusteuert: «Das Ende der Welt (wie wir sie kennen)».
Die Neigung von Journalisten, eine bestimmte Haltung einzunehmen und für das scheinbar Gute zu kämpfen, erscheint als berufliche Tendenz. Obwohl sich viele Journalisten dem Gedanken der Vielfalt verpflichtet fühlen, ist ihre Begeisterung für vielschichtige Debatten begrenzt. Sobald polarisierende Ansichten auftreten, warnen sie schnell vor einer «Spaltung». Dass Journalisten selbst zur Polarisierung beitragen können, wie zum Beispiel während der Flüchtlingskrise mit dem Imperativ «Refugees welcome», wird von vielen Kollegen in ihrem Aktivismus nicht bedacht.
Die “Zusammenland”-Kampagne dieses Jahres war bezeichnend für das Streben nach Einheit im deutschen Journalismus. Verschiedene Medienhäuser, darunter “Die Zeit”, “Süddeutsche Zeitung”, “Tagesspiegel” und “Handelsblatt”, schlossen sich mit 500 Unternehmen, Verbänden und Stiftungen zusammen, um gegen “dumpfen Populismus” und “Faschismus” vorzugehen. Ihr Motto lautete: “Nie wieder!”
Die Kampagne bezog sich auf ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, bei dem angeblich Pläne zur Vertreibung von Migranten diskutiert wurden. Landesweit kam es zu Demonstrationen. Obwohl die Kampagne die AfD nicht direkt erwähnte, wurde in der Anzeige betont: “Deutschland braucht keine Alternative zu Freiheit und Vielfalt.”
Anstatt die Unabhängigkeit ihrer Zeitungen zu betonen, streben diese Verlage danach, Teil einer politischen Bewegung zu sein. Sie suchen ein einstimmiges Bekenntnis zum Guten. „Ein Bekenntnis, das eigentlich jeder unterstützen kann“, sagte die Geschäftsführerin des „Handelsblatts“ und machte damit deutlich, dass diese Haltung die einzig wahre und richtige sei. Wer nicht Teil des „Zusammenlands“ ist, gerät bereits in Verdacht.
Diese Haltung wirkt sich auch auf den Journalismus aus und wird in der Berichterstattung sichtbar. Dabei sollte es gerade die Aufgabe von Journalisten sein, nicht Teil davon zu sein, sich dem Sog solcher Bewegungen zu entziehen und sie stattdessen kritisch zu hinterfragen. Wer selbst aktiv im Umzug mitmarschiert oder diesen gar organisiert, hat die Unabhängigkeit bereits aufgegeben.
Der Journalist Claas Relotius vom «Spiegel» erlangte besondere Berühmtheit. Sein vermeintlicher Haltungs-Journalismus entpuppte sich als fiktive Dichtung. Er verabschiedete sich vollständig vom Journalismus und erfand stattdessen Geschichten, die wie ausgefeilte Reportagen wirkten, und erzielte damit großen publizistischen Erfolg. Beispielsweise erfand er eine rührselige Geschichte über eine Frau, die durch die USA reist und als Zeugin bei Hinrichtungen fungiert, oder er ließ syrische Flüchtlingskinder von Angela Merkel träumen.
Relotius galt als Liebling der Branche, bis er 2018 intern enttarnt wurde und der «Spiegel» den Fall öffentlich machte.
Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, beschrieb das Phänomen folgendermaßen: «Relotius lieferte eine Ware, die erwünscht war, und das nicht nur vom ‹Spiegel›. Diese Ware zeichnete sich durch einen bestimmten Klang aus, den Jurys von Journalistenpreisen bevorzugten. Es ging aber auch um die Ideologie eines bestimmten intellektuellen Milieus. (…) Letztendlich war es für Relotius einfacher, solche Geschichten zu erfinden, als immer wieder aufwendig zu recherchieren, denn die Welt entspricht nicht immer den eigenen Wünschen.»
Der Chefredakteur der führenden linksliberalen Zeitung in Deutschland hat schließlich eine Wahrnehmung bestätigt, die auch viele Leser zu teilen scheinen: „Wir spiegeln den Alltag der Menschen, die uns lesen, zu wenig wider, besonders wenn sie nicht in Großstädten leben. Zudem zögern wir manchmal, uns mit den problematischen Aspekten der Migration auseinanderzusetzen – aus Sorge, Beifall von der falschen Seite zu erhalten und somit rechte Erzählungen zu unterstützen.“ Er betrachtet es als riskant, diese Themen zu ignorieren.
Das gleiche Studium, ähnliche Interessen, derselbe Geschmack und übereinstimmende politische Ansichten prägen oft das Bild von Journalisten. Unterschiedliche Umfragen haben die politische Homogenität unter Journalisten bestätigt, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Eine 2017 veröffentlichte Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ergab, dass sich fast 70 Prozent der SRG-Journalisten als links einstufen. Auch bei privaten Medien sahen sich etwa 62 Prozent als links.
Eine Umfrage der deutschen Branchenzeitschrift “Der Journalist” aus dem Jahr 2020 zeichnet ein drastisches Bild der politischen Einstellungen von ARD-Volontären: 57 Prozent äußerten Sympathie für die Grünen, 23 Prozent für die Linken, 12 Prozent für die SPD, während die Union 3 Prozent und die FDP 1 Prozent erreichten.
Dies verdeutlicht, wie die Medien sich vom Alltag der Menschen entfernt und an Glaubwürdigkeit eingebüßt haben. Der Begriff “Mainstream-Medien” ist ein Zeichen dafür. Ein weiteres sind Statistiken, die eine regelmäßige Erosion des Vertrauens in die Medien aufzeigen. Oder Umfragen wie die Allensbach-Studie von 2021, bei der 44 Prozent der Deutschen zustimmten, dass man seine Meinung nicht frei äußern könne.
Auch etablierte Medien tragen eine Mitverantwortung. Sie tendieren dazu, den Diskurs einzuschränken und abweichende Meinungen zu skandalisieren. Obwohl diese Medien an Deutungshoheit verlieren, werden sie noch wahrgenommen, zunehmend jedoch als strenge Aufseher des Diskurses. Das Vertrauen eines breiten Publikums kann nur durch kritischen und unabhängigen Journalismus zurückgewonnen werden – einen Journalismus, der sich nicht danach richtet, ob er mit der Mehrheit oder Minderheit konform geht.
Bild: Grok

Werden Sie Teil unserer Community und unterstützen Sie uns! Sie können uns in den Sozialen Netzwerken am besten auf Telegram oder auf X oder Facebook folgen, um unsere Inhalte zu empfangen. Oder noch besser melden Sie sich für unseren Newsletter an, um die Neuigkeiten des Tages zu erhalten.
Gerne können Sie auch Premium-Mitglied werden oder uns durch eine wirklich hilfreiche Spende unterstützen. Herzlichen Dank im voraus!
Abonnieren Sie unseren Newsletter