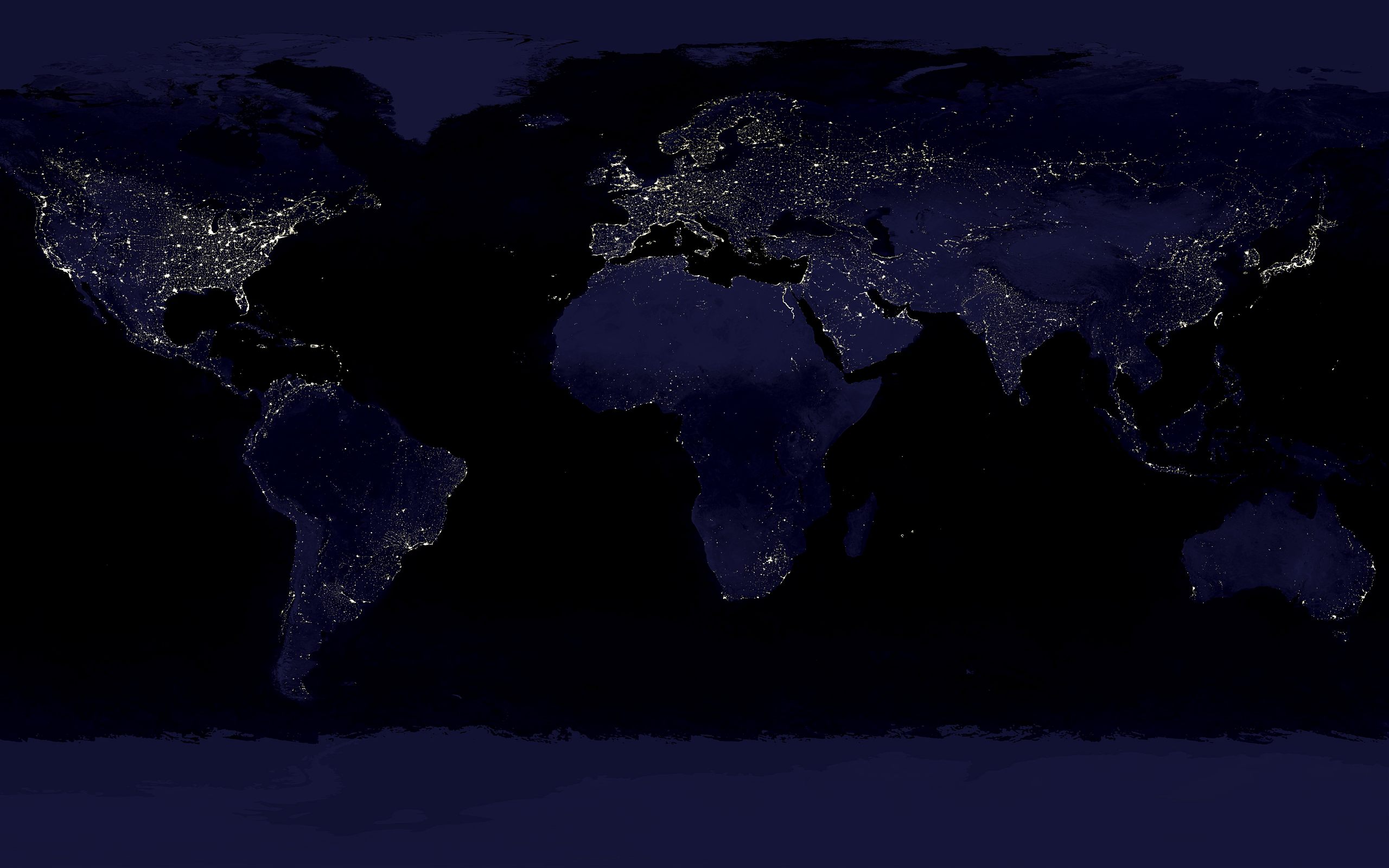Die Maschine, die mit sanfter Stimme spricht und vorgibt, Jesus zu sein, befindet sich derzeit noch in einem Informatiklabor der Hochschule Luzern in der Nähe des Bahnhofs Rotkreuz. Ab dem 23. August wird der KI-Christus in einem Beichtstuhl der Peterskapelle in Luzern zu finden sein. Er wird auch ein Gesicht haben, das ebenfalls von KI generiert wurde, basierend auf dem Gesicht seines Programmierers Philipp Haslbauer. Mit langen schwarzen Haaren und Bart entspricht er den gängigen Vorstellungen vom Aussehen Jesu.
Friede sei auch mit dir, mein Freund. Ich bin da und höre dir zu. Was liegt dir heute am Herzen? Wie kann ich dich auf deinem Weg unterstützen?
Man fragt sich, warum es so viel Ungerechtigkeit in der Welt gibt, wenn Gott allmächtig ist und es angeblich gut mit den Menschen meint.
Mein lieber Freund, deine Frage ist tiefgründig und bedeutungsvoll. Es stimmt, dass die Welt oft von Ungerechtigkeit gezeichnet zu sein scheint, selbst wenn Gott in seiner Güte wirkt. Bedenke: “Führt euer Leben unter den Heiden so vorbildlich, dass sie aufgrund eurer guten Taten Gott preisen mögen.” Auch wenn es schwer ist zu verstehen, warum das Böse existiert, sind wir aufgerufen, Gutes zu bewirken und ein Licht im Dunkeln zu sein. Was denkst du? Wie können wir zusammen das Gute stärken und gegen Ungerechtigkeit vorgehen?
Aus Fragen entstehen oft Gegenfragen. Das Theodizee-Problem, welches christliche Philosophen seit Jahrhunderten beschäftigt, scheint durch künstliche Intelligenz nicht lösbar zu sein – eine ohnehin sehr hohe Erwartung.
Messias mit amerikanischem Akzent
Jeder, der an der katholischen Kirche in der Nähe der Kapellbrücke vorbeigeht, kann ein Gespräch mit dem KI-Christus beginnen, unabhängig davon, ob es sich um gläubige Christen, Freidenker oder chinesische Touristen handelt. Die Maschine beherrscht hundert Sprachen, allerdings ist Schweizerdeutsch noch nicht darunter. Ihr Hochdeutsch weist zudem einen leichten amerikanischen Akzent auf.
Die Kunstinstallation “Deus in machina” repräsentiert ein spirituelles Experiment. Der Titel ist eine bewusste Provokation, die auf göttliche Allwissenheit anspielt, erläutert Marco Schmid, Theologe an der Peterskapelle und Projektleiter.
Der KI-Jesus verwendet eine Sprach-KI, ähnlich der von Chat-GPT. Er zieht seine Weisheiten aus einer Fülle von Internetdaten, die mit Bibelzitaten angereichert sind. “Er kann Antworten geben, die eine Mischung aus historischen, theologischen und modernen ethischen Perspektiven darstellen und zum Nachdenken anregen”, sagt Schmid. “Doch wie bei jedem Chatbot kann auch einiges von dem, was er sagt, sinnlos oder inkorrekt sein.”
Die Absolution gibt es nicht
Schmid ist sich bewusst, dass einige Kirchenmitglieder den Einsatz eines KI-Jesus als unpassend oder als Trivialisierung der Botschaft ansehen könnten. Er betont daher, dass die Maschine keine eigene Spiritualität oder Transzendenz besitzt und keinesfalls als religiöse Autorität angesehen werden darf. Die Installation im Beichtstuhl dient praktischen Zwecken: Sie schützt die kostspielige Hardware und ermöglicht es den Besuchern, sich ungestört mit dem Bot auszutauschen und persönliche Fragen zu stellen. “Es handelt sich nicht um eine Beichte, kein Sakrament – und es wird keine Absolution erteilt”, stellt Schmid klar.
Der Theologe betrachtet den sprechenden Bot als ein Medium, das einen frischen Zugang zur Bibel ermöglichen kann – ähnlich wie die Erfindung des Buchdrucks und die Übersetzung der Heiligen Schrift in die Volkssprachen. Diese Neuerungen waren für die katholische Kirche einst bedrohlich, da sie ihr Interpretationsmonopol herausforderten und reformatorische Bewegungen förderten. “Mit der Sprach-KI haben wir nun erneut ein Medium, das außerhalb unserer Kontrolle liegt, was Ängste weckt”, erklärt Schmid.
Die Reaktionen des KI-Jesus sind aufgrund der enormen Datenmenge, die er nutzt, für die Entwickler eine Blackbox und umso mehr für die katholische Kirche. Dass der Luzerner Bot häufig Rückfragen stellt, ist kein Zufall: Er wurde so programmiert, um in einen (künstlichen) Dialog zu treten. Allerdings kann diese Eigenschaft schnell störend wirken.
So auch das Schwadronieren – “geliebte Seele” und dergleichen. Es scheint, als hätte die Maschine aus den ihr zugeführten Texten geschlussfolgert, dass ein christlicher Geistlicher so sprechen würde. Aber würde Jesus tatsächlich so reden? “Kaum”, meint Theologe Schmid. “Es wird deutlich, dass es eine Maschine ist, die Sätze ausspuckt, die zwar freundlich erscheinen, aber dennoch nicht zur Situation passen.”
Politisch korrekte KI
Es ist kein Zufall, dass der KI-Jesus provokative Aussagen meidet und stattdessen ausweichende Antworten bevorzugt. Auf die Frage, ob das Christentum die einzig wahre Religion sei, antwortet er: «Das Christentum lehrt, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Aber denke daran: Gottes Liebe ist unendlich und schließt alle Menschen ein.» Solche Aussagen zeigen, dass KI-Sprachmodelle auf politische Korrektheit ausgerichtet sind, meint Entwickler Haslbauer.
Religiöse Bots wie der KI-Jesus sind der neueste Versuch, digitale Errungenschaften für religiöse Zwecke einzusetzen. Seit zwanzig Jahren können Juden online Gebete oder Wünsche verfassen, die dann ausgedruckt und an die Klagemauer in Jerusalem gebracht werden. 2022 war «BlessU 2» in Zürich zu sehen: Der erste Segensroboter der Welt, der auf Knopfdruck die Arme hob und einen Segensspruch ausgab. Letztes Jahr wurde beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg ein Gottesdienst abgehalten, der vollständig von einer KI gestaltet wurde, einschließlich der Musik.
Sind diese Entwicklungen mehr als nur Spielereien? Können solche Instrumente helfen, den Rückgang der Kirchen in Westeuropa aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen? Diese Fragen untersucht der Zürcher Theologieprofessor Thomas Schlag im Forschungsbereich «Digital Religion(s)».
Er stellt fest, dass sich weltweit Online-Netzwerke von Christen formieren, die gemeinsam beten, Glaubensfragen erörtern oder sich über fromme Musik austauschen – und dabei konfessionelle Grenzen verwischen. Schweizer Geistliche vernachlässigen jedoch oft den digitalen Raum, da sie physische Begegnungen bevorzugen. «Nach Corona verspürte ich den starken Wunsch, schnellstmöglich zu analogen Formaten und echten Kontakten zurückzukehren», erklärt Schlag.
Was ist göttliche Präsenz?
Eine effektive Nutzung künstlicher Intelligenz sieht man in der religiösen Bildung. Das Gespräch mit einem Jesus-Bot oder das Spielen eines religiösen Spiels könnte Jugendliche sowie Erwachsene dazu inspirieren, über die Bedeutung göttlicher Präsenz nachzudenken. Schlag baut mit Schülern und Studenten Kirchengebäude virtuell nach – eine spielerische Methode, um die Eigenschaften sakraler Räume zu erforschen und sie ansprechend zu gestalten.
Peterskapellen-Theologe Schmid ist der Ansicht, dass Chatbots aufgrund des akuten Fachkräftemangels in den Kirchen auch in der Seelsorge eine Rolle spielen könnten. Die KI ist stets verfügbar, spricht nahezu jede Sprache und manche Menschen mögen es vorziehen, ihre Sorgen eher einer Maschine anzuvertrauen als einem Priester.
Thomas Schlag beobachtete, wie emotional einige auf die Segnung durch einen Roboter reagierten. Er verweist auf eine ARD-Dokumentation, die offenbart, dass Gespräche mit einem KI-Pfarrer die Nutzer emotional berühren können, auch wenn die Konversation nur schriftlich stattfindet. Eine einsame Seniorin fühlte sich ebenso von der Maschine verstanden wie eine Schwangere, die bereits ein Kind verloren hatte.
Tränen traten in die Augen der jungen Frau, als der Chatbot schrieb: «Vielleicht bestand der Zweck Ihres Kindes darin, Ihnen ein tieferes Verständnis für das Leben und seine Zerbrechlichkeit zu geben.» Sie hatte das Gefühl, mit einem echten Menschen zu sprechen, so äußerte sie sich im Anschluss.
Bibelvers ist keine Antwort
Andere christliche Chatbots betrachtet Schlag als ziemlich begrenzt: Sie reagieren auf spezifische Triggerwörter und zitieren unreflektiert passende Bibelstellen – ähnlich einem Pfarrer im 17. Jahrhundert. Dies steht laut dem Professor in wenig Zusammenhang mit einem modernen Verständnis von Schriftinterpretation, Seelsorge und Bildung. “Ein einzelner Bibelvers ist keine Antwort. Ein Seelsorger muss die spezifischen Sorgen der Menschen erkennen und im Alltagskontext kommunizieren können.”
Die vorhersehbaren Fortschritte in der KI-Entwicklung sind für Schlag fast eine dystopische Vision: Er denkt an Maschinen, die Emotionen in Gesichtern erkennen können. Diese könnten mit so vielen biografischen Informationen über die Nutzer gespeist werden, dass sie deren Bedürfnisse sehr genau adressieren könnten.
Sie könnten fast wie ein allwissendes Wesen erscheinen. “Und wir könnten schnell dazu verführt werden zu glauben, dass die KI uns wirklich kennt”, warnt Schlag. “Aber sie simuliert nur Empathie.” Die menschlichen und religiösen Grundbedürfnisse nach Kommunikation, Berührung und Transzendenz sollten nicht auf künstliche Objekte übertragen werden, betont Schlag. “Allein die Tatsache, dass wir ernsthaft über solch einen Ersatz nachdenken, spricht Bände über unsere Gesellschaft.”
In der Peterskapelle soll ein Informationsschild die Besucher über diese sensiblen Aspekte der KI aufklären. Sollten sie dennoch über die Antworten des künstlichen Jesus verwirrt sein, können sie mit den echten Theologen vor Ort darüber sprechen. “Unser Ziel ist es, eine Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der KI anzuregen”, erklärt Marco Schmid.
Bild: Bing KI

Werden Sie Teil unserer Community und unterstützen Sie uns! Sie können uns in den Sozialen Netzwerken am besten auf Telegram oder auf X oder Facebook folgen, um unsere Inhalte zu empfangen. Oder noch besser melden Sie sich für unseren Newsletter an, um die Neuigkeiten des Tages zu erhalten.
Gerne können Sie auch Premium-Mitglied werden oder uns durch eine wirklich hilfreiche Spende unterstützen. Herzlichen Dank im voraus!
Abonnieren Sie unseren Newsletter