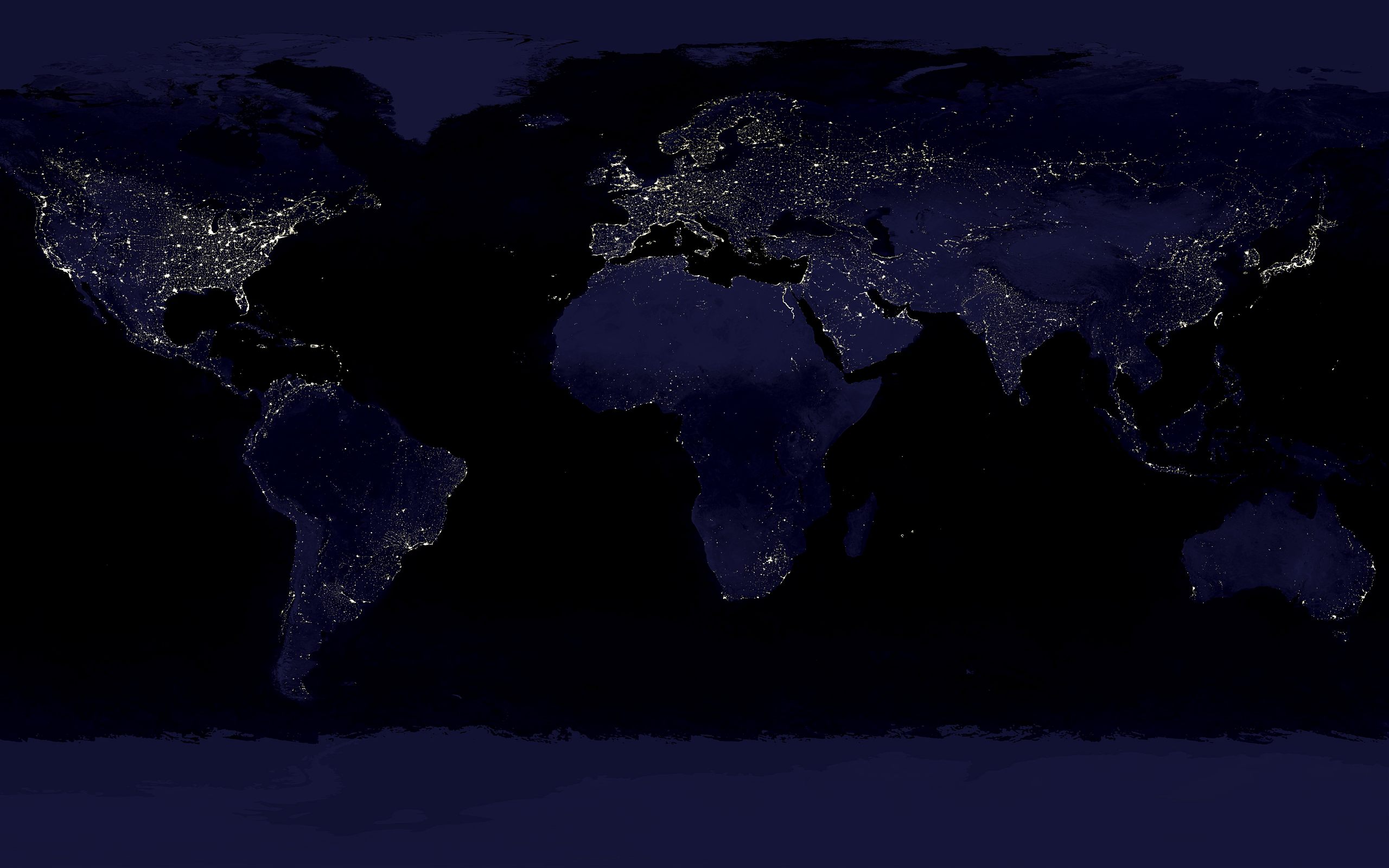Die österreichische Regierung hat sich einer wachsenden Zahl von Behörden weltweit angeschlossen, die aktiv nach Möglichkeiten suchen, die Einführung von Verschlüsselungs-Hintertüren in Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram zu fordern, die sichere Kommunikation bieten.
Der Anti-Verschlüsselungstrend setzt sich fort, obwohl sowohl Technologieexperten als auch Datenschützer immer wieder betonen, dass eine derartige Verschlüsselung nicht so umgangen werden kann, dass nur „die Guten“, wie Regierungen und Strafverfolgungsbehörden, Zugang erhalten, während böswillige Akteure ausgeschlossen bleiben.
Als Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Anfang der Woche über einen Gesetzesentwurf sprach, der die Überwachung zuvor privater Kommunikation über verschlüsselte Apps ermöglichen soll, hielt er an dem oft wiederholten Narrativ fest, dass die Polizei Zugang benötige, um „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ zu schaffen und gleichzeitig „Terroristen und Extremisten“ zu bekämpfen.
Diese Definition bezieht sich offenbar auf Personen, die an „verfassungsgefährdenden Aktivitäten“ beteiligt sind.
Trotz dieser weit gefassten Definition wagte es Karner, die Prognose aufzustellen, dass die Polizei die vorgeschlagenen, erheblichen neuen Befugnisse lediglich zur Untersuchung „einiger Einzelfälle pro Jahr“ nutzen werde.
Ohne zu erläutern, wie er auf diese Zahl kam – oder wie eine solche Vorhersage überhaupt möglich ist, es sei denn, es handelt sich um einen Versuch, den Widerstand gegen solche Maßnahmen zu minimieren – erklärte der Minister weiter, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre neuen Überwachungsmöglichkeiten auf Fälle beschränken würden, in denen der Verdacht auf einen bevorstehenden Terroranschlag besteht oder eine terroristische Vereinigung gebildet wird. „Es kann auch zur Spionage genutzt werden“, so Karner.
Gleichzeitig versicherte er, dass „die Bevölkerung davon nicht betroffen ist“.
Das bedeutet, dass die Bevölkerung darauf vertrauen muss, dass die Regierung und ihre Strafverfolgungsbehörden zu keinem Zeitpunkt die Macht missbrauchen, um auf ihre Nachrichten zuzugreifen und diese für undemokratische Zwecke wie die Massenüberwachung zu lesen.
Obwohl solche Befürchtungen durchaus berechtigt sind, wies Karners Koalitionspartner, Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), diese zurück und erklärte, er sehe „keine Gefahr einer Massenüberwachung“, die von dem Gesetzentwurf ausgehe.
Anstatt die Gründe dafür näher zu erläutern, fuhr Leichtfried fort, „der Bevölkerung“ zu sagen, wie sie sich fühlen sollte, und forderte im Grunde genommen blindes Vertrauen.
„Die Bevölkerung sollte das Gefühl haben, dass das Land sicherer wird“, wird der Beamte zitiert.
Der dritte Partner in der Regierungskoalition, NEOS, zeigt sich jedoch nicht ganz einverstanden.
Karner ist jedoch überzeugt, dass die beiden anderen Parteien in der Lage sein werden, NEOS während der „langen Überprüfungsphase von acht Wochen“ des Entwurfs zu überzeugen.

Werden Sie Teil unserer Community und unterstützen Sie uns! Sie können uns in den Sozialen Netzwerken am besten auf Telegram oder auf X oder Facebook folgen, um unsere Inhalte zu empfangen. Oder noch besser melden Sie sich für unseren Newsletter an, um die Neuigkeiten des Tages zu erhalten.
Gerne können Sie auch Premium-Mitglied werden oder uns durch eine wirklich hilfreiche Spende unterstützen. Herzlichen Dank im voraus!
Abonnieren Sie unseren Newsletter